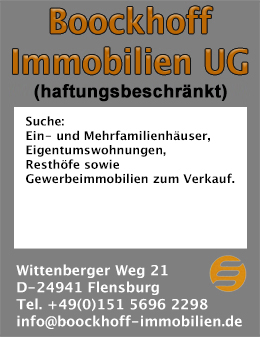- Details
- Nachgefragt
Früher war mehr Tatort
Einst gehörte der „Tatort“ zu den guten Krimis. Sonntagabend war Tatort-Zeit. Spannende Unterhaltung mit vielen überraschenden Winkelzügen, die sich erst zum Ende hin entwirren ließen.
Die Handlung der Filme bezog sich immer auf die Kriminalfälle. Die Kommissare/innen waren Menschen, die mitten im Leben standen, sie hatten ihre Stärken und Schwächen. Auch hatten sie ein Privatleben, das aber nicht der Hauptgegenstand der Handlung war. Kleiner Wermutstropfen: das Telefon klingelte immer, wenn man sich gerade zum Essen gesetzt hatte und den ersten Bissen zu sich nehmen wollte. Das Essen blieb stehen, Tote können nicht warten. Das Entscheidende war aber, sie waren psychisch gesund. Nicht, dass sie nicht auch ihre Macken gehabt hätten, so die Münchner Ermittler, die agierten ständig wie ein sich anzickendes Ehepaar, sie waren aber nicht durchweg Kandidaten für dringende psychiatrische Behandlungen.
In den heutigen „Tatorten“ sind die Ermittler/innen gefrustet und psychisch lädiert bis eigentlich arbeitsunfähig. Sie schleppen schwere Traumata mit sich herum, haben desaströse Familienverhältnisse und sind zur Selbstreflektion nicht in der Lage, borniert, hätte man früher dazu gesagt. Neue Kollegen/innen werden grundsätzlich von oben herab behandelt. Die Chefs sind durchweg Deppen, tauchen auf, schwurbeln dummes Zeug und treten wieder ab. Gefährlichen Situationen begegnet man absichtlich gerne im Alleingang. Abzusehen ist dabei immer, sie werden in Schwierigkeiten geraten und erst in allerletzter Sekunde vor dem drohenden Todesstoß gerettet. So vorhersehbar und langweilig. Die Handlungen beziehen sich zur Hauptsache auf die persönliche Hoffnungslosigkeit der handelnden Ermittler/innen. Untermalt wird das Ganze mit irreführenden Szenen, die sich dann als Fantasien oder Träume herausstellen. Inzwischen wartet man regelrecht darauf, wann die Ermittelnden mit einem Stoßseufzer und irrem Blick aus diesen Träumen/Tagträumen aufschrecken. Nichts passiert, aber hätte ja sein können. Der kriminalistische Strang ist innerhalb von fünf Minuten erzählt, der Rest sind die privaten Schicksalsschläge und die Übernahme des Films durch die Kameraleute. Endlos Hinterköpfe, die sich durch Treppenhäuser und Flure bewegen. Nicht enden wollende Großaufnahmen der Handelnden, frustriert, grantig, traurig oder sinnierend dreinschauend. Und Autofahrten: lange Wege durch die Stadt, über Land, mal mit Bäumen am Straßenrand, mal ohne, gerne auch sich wiederholende Drohnenaufnahmen: Tannen von oben, Häuserblocks von oben. Eingeschoben Großaufnahmen der Autoinsassen, dreinschauend wie eben beschrieben. Wahrscheinlich soll so der künstlerische Anspruch des Films hervorgehoben werden. Der eigentliche Sinn eines Krimis bleibt dabei völlig auf der Strecke.
Und nicht zuletzt die „musikalische“ Untermalung: Laut muss sie sein, durchdrungen von jaulenden, fiepsenden, metallischen Geräuschen, welche die Dialoge bis zur Unkenntlichkeit übertönen. Anfangs hatte ich schon befürchtet, dass mich ein Tinnitus erwischt hat. Wenn dann auch noch genuschelt oder undeutlich gesprochen wird……
Als bekennender Hardcore-Tatort-Fan habe ich bei einigen Tatorten abgeschaltet, nach zähem inneren Ringen und dem unbedingten Willen durchhalten zu wollen. Ich bin gescheitert. Und so saß ich dann frustriert, grantig, traurig oder sinnierend dreinschauend vor dem Fernseher. "Der Herr des Waldes" hat das Fass zum Überlaufen gebracht.
Wolfgang Claussen